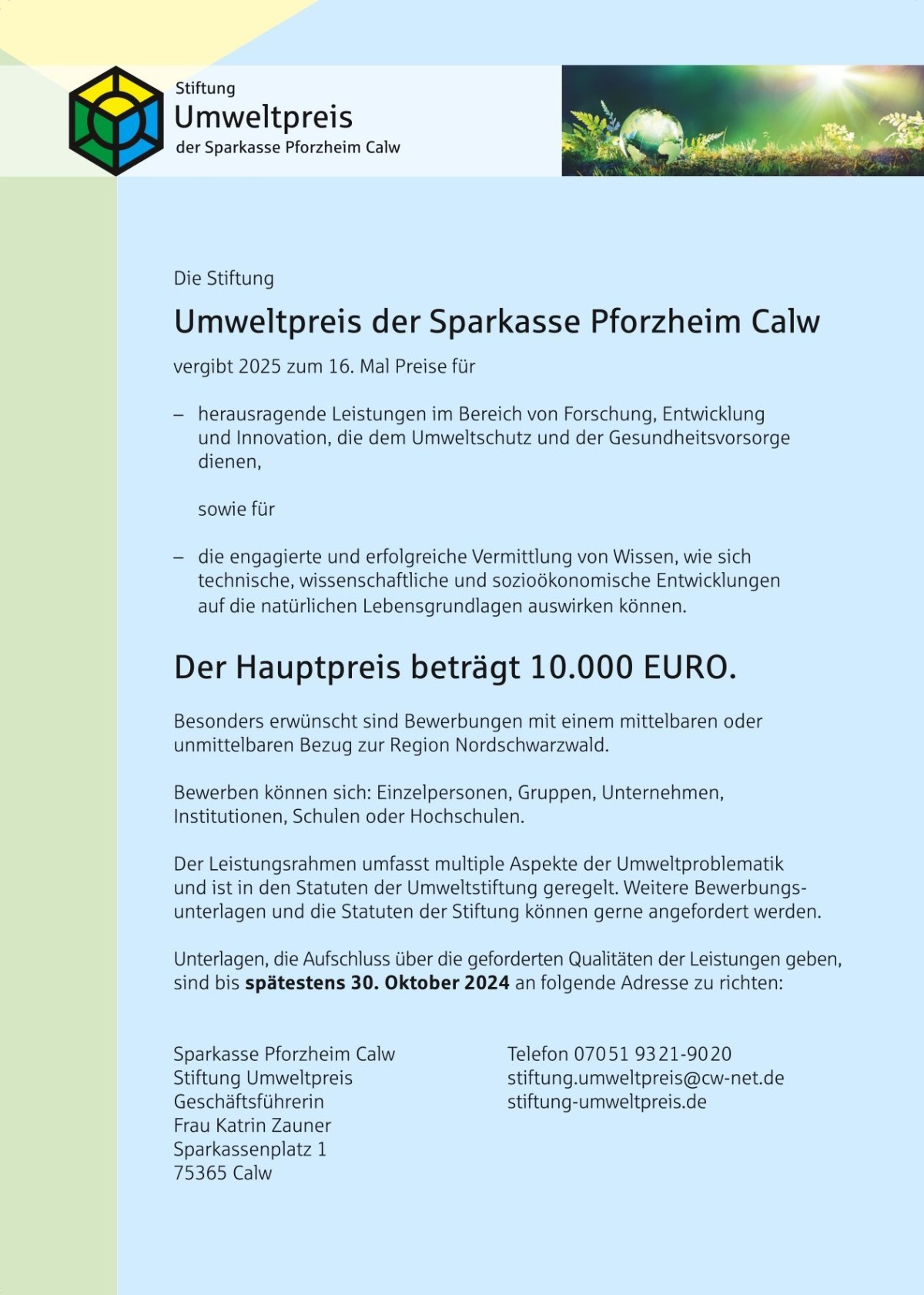Stiftung Umweltpreis
der Sparkasse Pforzheim Calw

Die Stiftung Umweltpreis wurde 1995 von der damaligen Kreissparkasse Calw ins Leben gerufen. Alle zwei Jahre vergibt die Stiftung einen Umweltpreis, welcher im Zuge einer öffentlichen Veranstaltung verliehen wird.
Der Hauptpreis beträgt 10.000 EUR.
Der Preis wird verliehen für:
- herausragende Leistungen im Bereich von Forschung, Entwicklung und Innovation, die dem Umweltschutz und der Gesundheitsvorsorge dienen
- die engagierte und erfolgreiche Vermittlung von Wissen, wie sich technische, wissenschaftliche und sozioökonomische Entwicklungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen auswirken können
Kuratorium
Fünf Professor/inn/en aus ganz Deutschland, ein Wissenschaftsjournalist, Landrat Helmut Riegger und die Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Pforzheim Calw Hans Neuweiler und Sven Eisele bilden ein Kuratorium, das über die Vergabe des Umweltpreises entscheidet.
Vorsitzender
Landrat Helmut Riegger
Landrat des Landkreises Calw

Prof. Dr. Johannes Steidle
Universität Hohenheim, Fachgebiet Chemische Ökologie
Dr. Paul Janositz
Freier Journalist
Hans Neuweiler
Stv. Vorsitzender
Prof. Dr. Andrea Hartwig
Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Angewandte Biowissenschaften


Prof. Christoph Kuhn
Technische Universität Darmstadt, Fachbereich Architektur
Prof. Dr. Reinhard Rauch
Engler-Bunte-Institut Karlsruhe, Fachgebiet Chemische Konversion Erneuerbarer Energien
Sven Eisele
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Pforzheim Calw
Stiftung Umweltpreis vergibt
Umweltpreise 2023
Die Umweltstiftung der Sparkasse Pforzheim Calw zeichnet vier Projekte mit dem Umweltpreis 2023 aus. Die Verleihung der mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Preise fand am 15. März 2023 in der Sparkasse in Calw statt.
- Dr. Alireza Javadian und Dr. Nazanin Saeidi, Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), für „NEWood“. In diesem Forschungsprojekt werden biobasierte, nachhaltige und erneuerbare Materialien entwickelt, die herkömmliche Holzprodukte vollständig ersetzen können.

- Lukas Dufner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart, für das Projekt: „Photokatalytische Trinkwasseraufbereitung mit Sonnenlicht“. Mittels eines alternativ konzipierten, einfach zu bauenden Reaktors kann verunreinigtes Trinkwasser in Entwicklungsländern und infrastrukturschwachen Regionen gesäubert werden.

- Prof. Dr.-Ing. Klemens Gintner von der Hochschule Karlsruhe (HKA) für die erstmalige Messung von Brutparametern, die für die Nachzucht gefährdeter Vögel bedeutend sind.

- Die Gemeinde Neuhausen (Enzkreis) für die Einrichtung eines „WaldKlimaPfads“, der an Spiel- und Informationsplätzen über die Folgen der Erderwärmung informiert: Nicht nur das Holz wird knapp, auch viele Tier- und Pflanzenarten sind bedroht.

Umweltpreis
Unterstützung von
Forschung und
Entwicklung für eine
bessere Umwelt.
Bewerbung
Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen, Institutionen, Schulen oder Hochschulen. Der Bewerberschwerpunkt für den Umweltpreis liegt überwiegend auf der Region Nordschwarzwald. Ist die eingereichte Innovation aber für die ganze Region nützlich, werden auch Bewerber aus dem ganzen Bundesgebiet zugelassen. Der Leistungsrahmen umfasst multiple Aspekte der Umweltproblematik und ist in den Statuten der Stiftung Umweltpreis geregelt.
Bewerbungsfrist ist abgelaufen
Pfiffige Lösungen erhalten Sparkassen-Umweltpreise
Auszeichnungen von 20 000 Euro in Calw verliehen – Dritter Preis an Schülerinnen aus Altensteig
Effektive Windräder, Trinkwassergewinnung in Afrika und die Vermeidung von Mikroplastik. Zu diesen Themen fanden die Teams, die mit dem Umweltpreis 2021 der Sparkasse Pforzheim Calw ausgezeichnet wurden, pfiffige Lösungen. Die Verleihung der mit insgesamt 20 000 Euro dotierten Auszeichnungen fand in der Calwer Sparkassen-Kundenhalle statt.
Hans Neuweiler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Pforzheim Calw, hob in seiner Begrüßung hervor, dass die Stiftung Umweltpreis bereits seit 1995 besteht und unterstrich, Umweltschutz sei für sein Haus keinesfalls nur „ein grünes Mäntelchen“. Bis 2035 soll die größte Sparkasse im „Ländle“ nämlich klimaneutral sein.
Drei Mitglieder des Stiftungs-Kuratoriums, dem Landrat Helmut Riegger vorsitzt, erläuterten die Preisvergaben.
Der mit 8 000 Euro dotierte Hauptpreis ging an drei Doktoranden der ZF Friedrichshafen für die Entwicklung eines Algorithmus, mit dem sich Schäden an Windkraftanlagen frühzeitig erkennen und so die Ausfallzeiten stark verkürzen lassen.
Drei Teams der ForscheHilda AG des Hilda Gymnasiums Pforzheim erhielten den zweiten Preis und 7 000 Euro. Sie haben sich intensiv mit technischen, gesellschaftlich und entwicklungspolitisch relevanten Projekten in Tansania befasst: der Trinkwassergewinnung, der Pflanzenzüchtung und der Versorgung isolierter Wohnbereiche mit elektrischer Energie.
Den dritten Preis – verbunden mit 5 000 Euro – erhielten zwei Schülerinnen des Christophorus-Gymnasiums Altensteig. Sie haben einen Filter entwickelt, der, in Waschmaschinen eingebaut, Mikroplastik effektiv aus dem Abwasser herausholen kann.
Der stellvertretende Kuratoriums-Vorsitzende Prof. Dr. Konrad Dettner machte in seiner Erläuterung deutlich, dass es bis zu 2 000 Jahre dauern kann, bis aus Plastikabfall in der Umwelt Mikroplastik entsteht. Statistisch gesehen produziert jeder Mensch davon vier Kilogramm pro Jahr. Mikroplastik entsteht hauptsächlich beim Waschen, durch Reifenabrieb und ist im Feinstaub enthalten. Es ist heute in der gesamten Wassersäule nachweisbar und auch der Mensch enthält große Mengen davon. Luise Florentine Mast und Hannah-Marie Zakes haben nach langen Versuchsreihen einen hochwirksamen Filter konstruiert, der verhindert, dass Mikroplastik ins Abwasser gelangt. Bei der technischen Umsetzung half die Friedrich Boysen AG.

Dr. Paul Janositz erklärte anschaulich, warum die ForscheHilde AG – bereits zum vierten Mal – mit einem Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Die drei prämierten Teams fanden ihre Themen durch den Austausch mit einer Partner-Mädchenschule in Tansania. Nur 40 Prozent der Menschen dort haben Zugang zu sauberem Wasser. Die Stromversorgung fällt häufig aus, oft kommt der Strom aus Batterien, mit allen daraus folgenden Umweltproblemen. Eines der Hilda-Teams hat ein preiswertes System entwickelt, das der Luft mittels poröser Granulate Feuchtigkeit entzieht und dann wieder abgibt. Eine weitere Schülergruppe hat ein autarkes Gewächshaus mit optimierter Wachstumsrate und geringem Feuchtigkeitsverlust konstruiert. Und das dritte Hilda-Team hat sich ein Gleichspannungsnetz ausgedacht, das ländliche Gebiet mit 12- oder 24-Volt-Strom versorgen kann. Solarzellen erzeugen den Strom, Akkus speichern die Energie.

Die Innovation der Hauptpreisträger erklärte Prof. Dr.-Ing habil. Hermann Nirschl. Zwei junge Mathematik-Doktoranden und ein Ingenieur der ZF Friedrichshafen haben ein System realisiert, das Windkraftanlagen durch verringerte Wartungszeiten deutlich effizienter macht. Mit ihrem Algorithmus lassen sich Unregelmäßigkeiten in Windturbinen früh erkennen. Weil so Verschleiß rechtzeitig erkannt und durch schnelle Wartung behoben werden kann, sinkt die Ausfallzeit von durchschnittlich sieben auf nur noch drei Tage. Eine Ersparnis von jährlich 1,7 Millionen Kilowattstunden. Dafür erhielten Jonas Schmidt, Johannes Bernhard und Mark Schutera den Hauptpreis der Sparkassen-Umweltstiftung.

Vergangene Preisträger

„Mast räumt bei Bundeswettbewerb ab“
Im letzten Jahr von unserer Sparkassenstiftung mit einem Umweltpreis in Höhe von 5.000 € (zusammen mit Partnerin Hannah-Marie Zakes) ausgezeichnet, erreicht Luise Florentine Mast mit

Umweltpreis der Sparkasse Pforzheim Calw 2019
Die Umweltstiftung der Sparkasse Pforzheim Calw verleiht am 22. Mai in Calw die Auszeichnungen für 2019. Die mit insgesamt 11000 Euro dotierten Preise gehen an:

Vom Beton zum Bio-Beton – Lokales Material von globaler Bedeutung
Dr. Dipl.-Ing. Wolfram Schmidt forscht in der Abteilung „Bauwerksicherheit“ der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin.

Wasserstoff jetzt!
Keine Nachhaltigkeit ohne Energiewende Prof. Dr. Robert Schlögl spricht zum Thema „Wasserstoff jetzt“. Der renommierte Chemiker geht zunächst auf die aktuelle durch den Ukrainekrieg hervorgerufene
Presseschau
- "Mast räumt bei Bundeswettbewerb ab" /// Schwarzwälder Bote, 31.05.2022
- "Umweltpreis hat richtig Fahrt aufgenommen" /// Schwarzwälder Bote, 29.05.2019
- "Die Forsche Hilda AG" /// Pforzheimer Kurier, 24.05.2019
- "Forsche Hilda AG holt den zweiten Platz" /// Pforzheimer Zeitung, 25.05.2019
- "ForscheHilda AG erneut ausgezeichnet“ /// Pforzheimer Kurier 29.10.2021
- „Großer Erfolg beim Umweltpreis“ /// Pforzheimer Zeitung 30.10.2021
- „Wassergewinnung und Mikroplastik“ /// Schwarzwälder Bote 03.11.2021
Umweltforum
Seit 1998 findet in den Jahren zwischen den Preisverleihungen in Calw im Herbst ein Umweltforum mit einem für die Öffentlichkeit interessanten Thema statt.
Termine
Rückblick

Vom Beton zum Bio-Beton – Lokales Material von globaler Bedeutung
Dr. Dipl.-Ing. Wolfram Schmidt forscht in der Abteilung „Bauwerksicherheit“ der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin.

Wasserstoff jetzt!
Keine Nachhaltigkeit ohne Energiewende Prof. Dr. Robert Schlögl spricht zum Thema „Wasserstoff jetzt“. Der renommierte Chemiker geht zunächst auf die aktuelle durch den Ukrainekrieg hervorgerufene